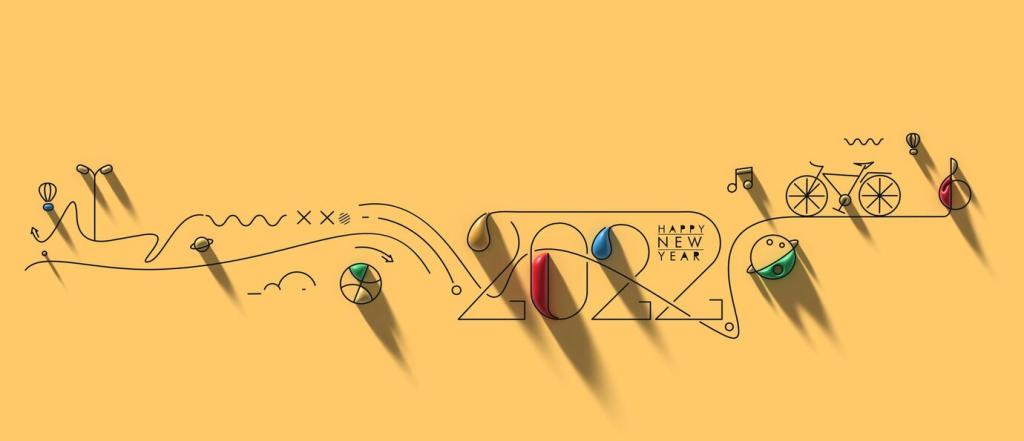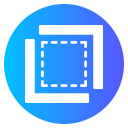This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Geschichte und Ursprünge des minimalistischen Innendesigns
Minimalistisches Innendesign hat sich zu einer der einflussreichsten Gestaltungsphilosophien der modernen Architektur und Innenausstattung entwickelt. Seine Ursprünge lassen sich auf verschiedene kulturelle, künstlerische und soziale Bewegungen zurückführen, die sich über Jahrhunderte entwickelt haben. Dieses Designkonzept betont Einfachheit, Funktionalität und das Weglassen alles Überflüssigen, um Räume zu schaffen, die Ruhe und Klarheit ausstrahlen. Die Geschichte des Minimalismus ist vielfältig und verbindet Traditionen aus Asien, Europa und den USA. Im Folgenden wird die Entwicklung dieses wichtigen Stils detailliert untersucht, um seine tief verwurzelten Prinzipien und seine heutige Bedeutung für die Innenarchitektur besser zu verstehen.
Früheste Einflüsse und kulturelle Wurzeln
Einfluss der abstrakten Kunst
Die Minimal Art Bewegung
Expressionismus und Funktionalismus als Vorläufer
Technologische und gesellschaftliche Entwicklungen


Ludwig Mies van der Rohe

Le Corbusier und die funktionale Einfachheit
Reaktion auf Überfluss und Dekadenz
Die Rolle der amerikanischen Minimal Art
Fortschritte in der Wohnkultur
Minimalismus und nachhaltiges Wohnen